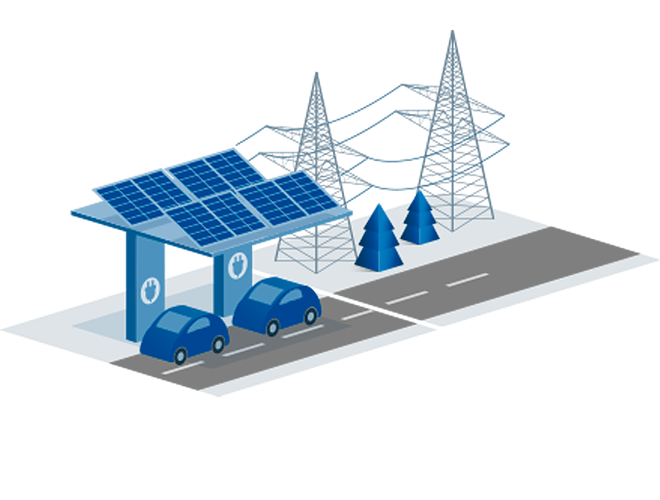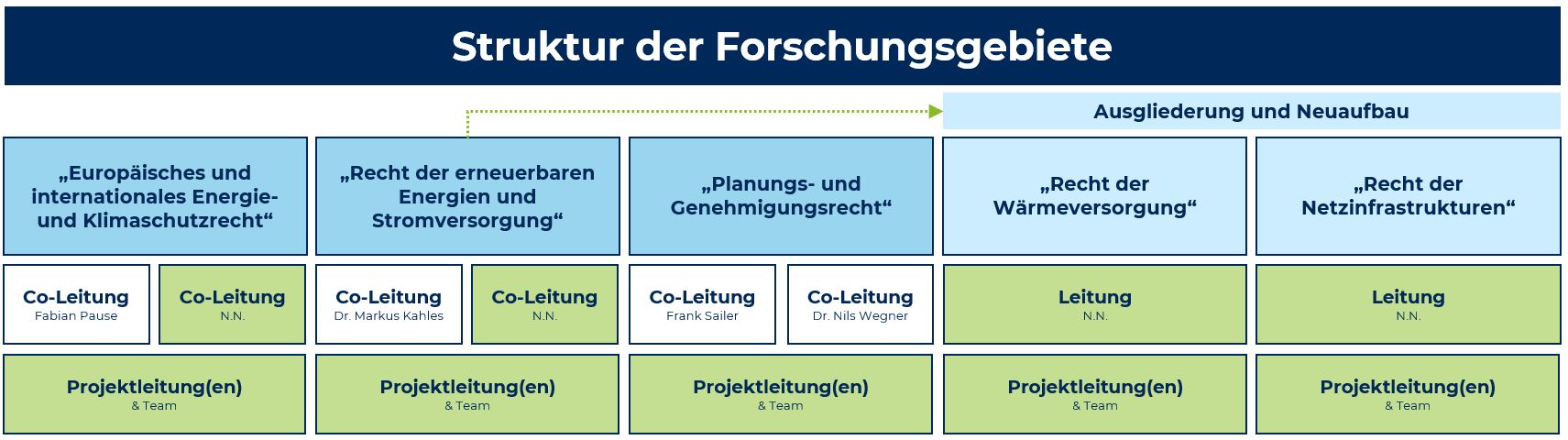Im Rahmen der Veranstaltung „§ 42c Energiewirtschaftsgesetz – neue Chancen für Energy Sharing?“ des Forum EnShare des Future Energy Lab (FEL) hielt Anna Papke von der Stiftung Umweltenergierecht einen Vortrag mit dem Titel „Rechtliche Analyse des regulatorischen Rahmens für Energy Sharing“.
In ihrem Vortrag ging sie darauf ein, wie sich die neu ins EnWG aufgenommene Norm für Akteure umsetzen lässt: Dies betrifft in erster Linie Bürger, Bürgerenergiegenossenschaften und andere Berechtigte, die selbst Energy Sharing betreiben. Daneben hat die Vorschrift aber auch Auswirkungen auf Netzbetreiber und andere Marktakteure. Auch ist eine Ausstattung mit intelligenter Messtechnik für das Energy Sharing Voraussetzung.
Weiterhin wurde im Vortrag auch das Verhältnis von Energy Sharing und EEG-Förderung beleuchtet: Zwar ist Energy-Sharing-Strom selbst nicht förderfähig, der erzeugte Strom kann aber anteilig teils über Energy Sharing und teils über die geförderte Direktvermarktung vermarktet werden.